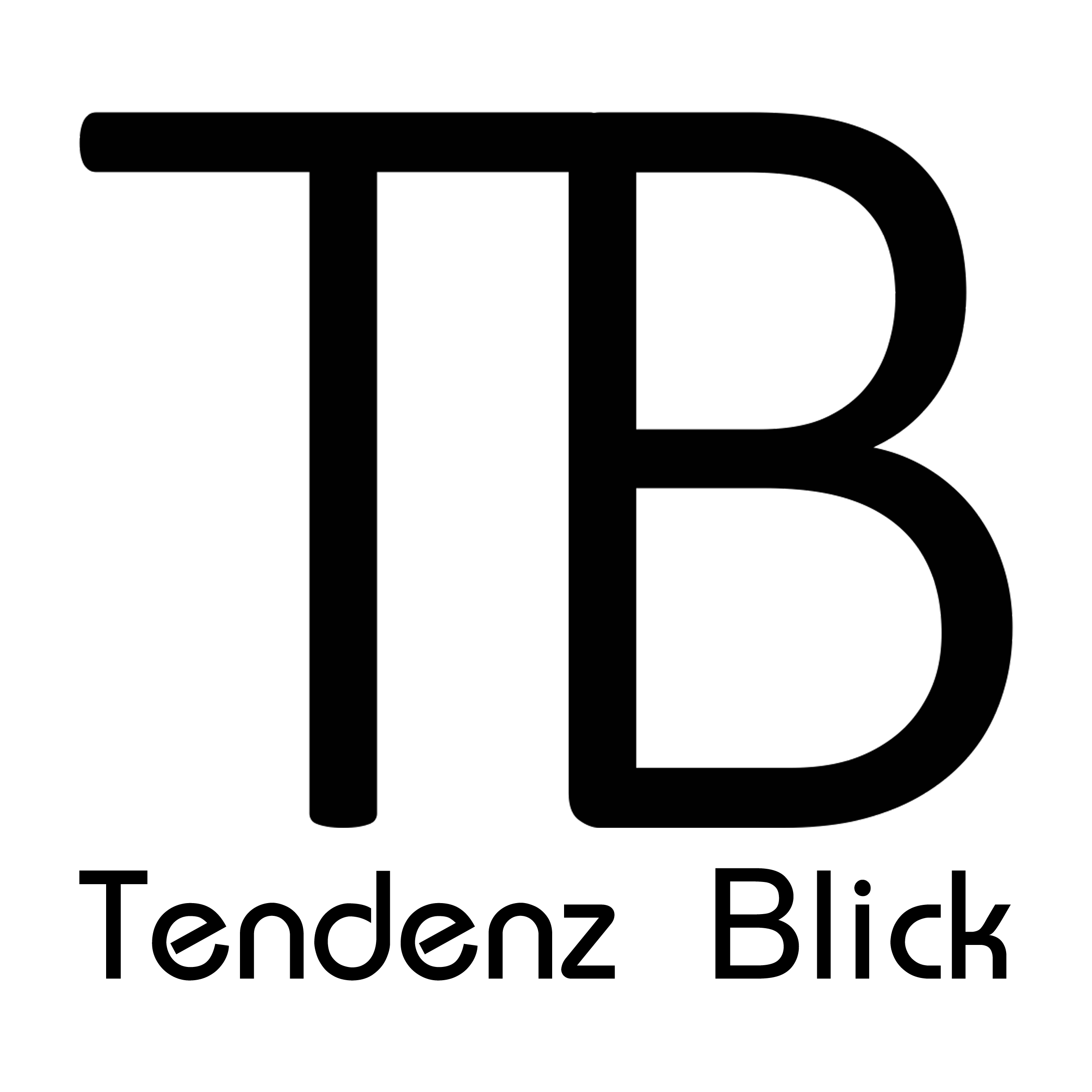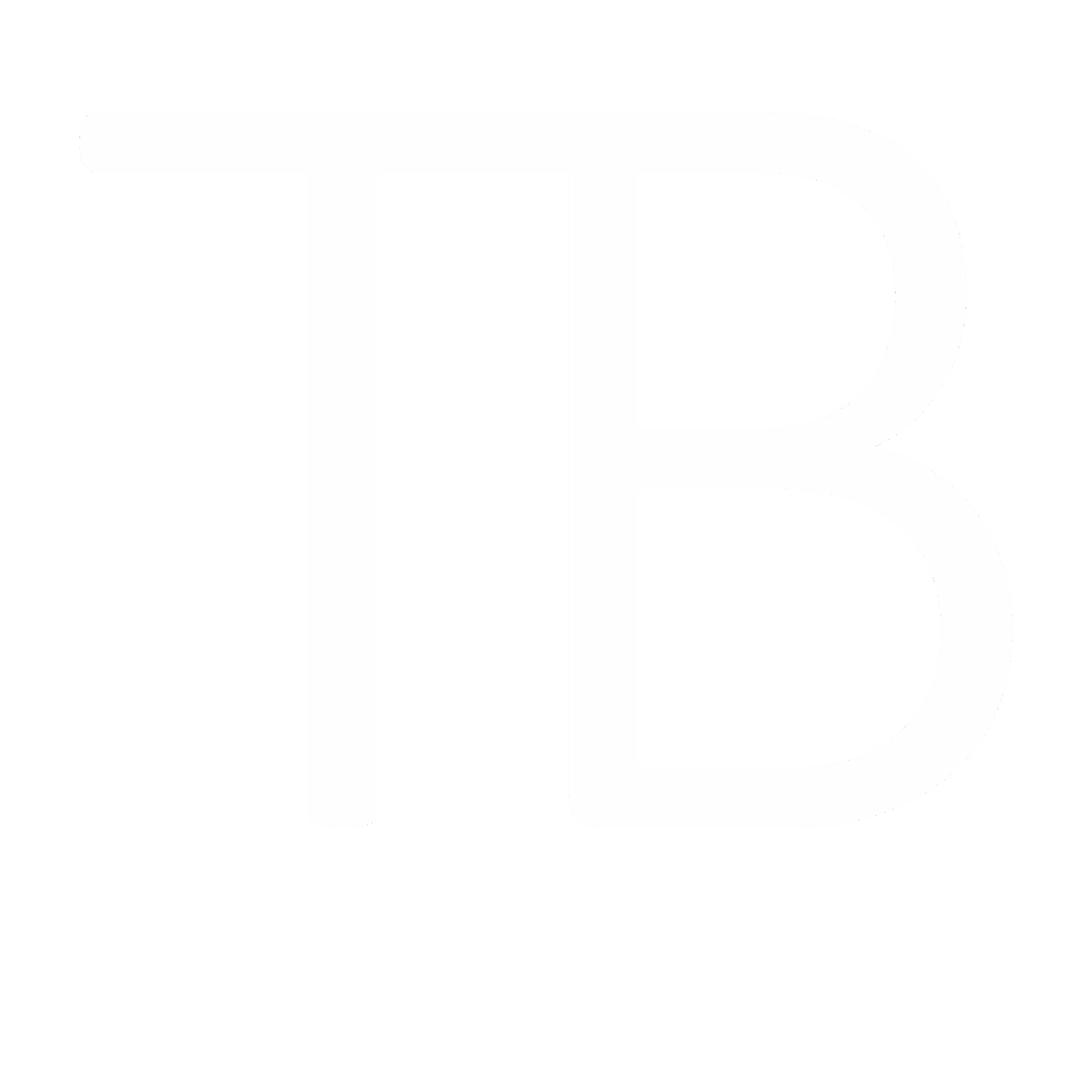China gegen den Westen: Von Kant über »Habeimasi« zu »Tianxia«

Dass Philosophie ihre Zeit in Gedanken gefasst ist, war die feste Überzeugung des vor 250 Jahren geborenen Georg Wilhelm Friedrich Hegel.[1] Und wer wollte bestreiten, dass unsere Zeit an der Schwelle einer Konfrontation zweier Weltmächte, der USA und Chinas, steht, eine Zeit, die mithin auch durch die Konfrontation zweier Philosophien geprägt wird: eines westlichen, die Menschenrechte in sein Zentrum stellenden Universalismus, sowie eines Universalismus der friedlichen Koexistenz unterschiedlicher Systeme – sogar für den Fall, dass diese keine Freiheitsrechte garantieren. Dieser Konflikt zeigt sich unter anderem daran, dass gegenwärtig eine aus China kommende, erklärtermaßen neokonfuzianische Philosophie gegen die klassische liberale Philosophie, etwa von John Rawls, in Stellung gebracht wird – und diese dabei sogar so weit geht, das Prinzip des „one man, one vote“ zu bestreiten und für eine autoritäre Meritokratie einzutreten.[2]
Diese philosophische Auseinandersetzung hat auch ihren Sitz in der politischen Realität: So betreibt China im Schatten der Corona-Pandemie eine neue Außenpolitik, die – siehe die Einschränkungen demokratischer Freiheiten in Hongkong, aber auch die weiter vorangetriebene Neue Seidenstraße – nur wenig unversucht lässt, westliche Regierungen und Öffentlichkeiten auch geistig zu beeinflussen.[3] Damit verdichten sich die Hinweise auf eine auch philosophische Konkurrenz zwischen China und dem „Westen“ – sofern man heute, angesichts der massiven Zerwürfnisse zwischen den Vereinigten Staaten unter Donald Trump und Europa überhaupt noch von „dem Westen“ sprechen kann.
Das alles vollzieht sich just 75 Jahre nach der menschen- und völkerrechtlich entscheidenden Reaktion der Siegermächte Großbritannien, USA und UdSSR auf das Ende des Zweite Weltkriegs mit seinen 52 Millionen Toten und dem menschheitsgeschichtlich einmaligen Verbrechen der Shoah – nämlich der förmlichen Gründung der Vereinten Nationen am 24. Oktober 1945. Zuvor hatten fünfzig Unterzeichnerstaaten von April bis Juni desselben Jahres in San Francisco die UN-Charta verabschiedet. „Wir, die Völker der Vereinten Nationen“, betonen in der Präambel ihre feste Entschlossenheit, „künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen, Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können, den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern.“
Damit wurde das, was sich als politisch-moralischer Universalismus bezeichnen lässt, durch die UN-Charta seinem Anspruch nach institutionelle Realität. Idee und tatsächliche, realpolitische Wirklichkeit dieses Universalismus aber stehen gegenwärtig in der Kritik – seitens der sich inzwischen immer stärker etablierenden Weltmacht China, aber auch von „postkolonialer“ Seite. Dabei richtet sich diese Kritik nicht zuletzt gegen Immanuel Kant, der speziell mit seiner 1795 publizierten Schrift „Zum ewigen Frieden“[4] zu einem, ja vielleicht sogar zu dem wichtigsten Stichwortgeber der Charta der Vereinten Nationen wurde.[5]
War Kant ein Rassist?
Kant galt bisher als der Philosoph der Aufklärung, als Denker der autonomen Moral sowie der menschlichen Würde. Berühmt geworden ist seine Definition von Aufklärung als „Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit“.[6] Der von ihm postulierte, jedem Menschen aus Freiheit einsichtige kategorische Imperativ aber lautet: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“, dem folglich Gültigkeit für alle Menschen gleichermaßen zukommen soll.[7] Dementsprechend war es Kant, der die Bedeutung des Ausdrucks „Würde“ als Erster entfaltete – und der deshalb auch als geistiger Vater des Grundgesetzes zu gelten hat, in dessen Artikel 1 die Würde des Menschen bekanntlich als unantastbar statuiert wird –, wenngleich vor ihm mit Pico della Mirandola (1463-1494) bereits ein Philosoph der italienischen Renaissance als Erster die „Würde des Menschen“ postuliert hatte.[8]
Bei Kant bedeutet Würde in erster Linie, dass Menschen niemals nur zu Mitteln gemacht werden dürfen: „Im Reich der Zwecke hat alles seine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle“, so Kant in der „Metaphysik der Sitten“, „kann auch etwas anderes gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, das hat eine Würde.“[9] Menschen aber haben nach Kant deswegen „Würde“, weil sie grundsätzlich einer autonomen moralischen Urteilsbildung fähig sind: „Autonomie ist also der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur.“[10]
Es ist insofern von besonderer Ironie, dass just in diesem, historisch wie realpolitisch so aufgeladenen Jahr Immanuel Kant – seiner auf Vernunft und Autonomie beruhenden Theorie des Rechts und der Moral zum Trotz – als Rassist in Verruf geraten ist. Weltweit wurden nach der Ermordung des schwarzen US-Amerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten im Frühsommer 2020 die Denkmäler gestürzt. Dabei wurde speziell in den Feuilletons deutscher Zeitungen auch Kants Denkmal, wenn schon nicht gestürzt, so doch mindestens beschädigt. Während Floris Biskamp gegen Kant eine „Kritik der weißen Vernunft“ anmahnte, warf ihm Frank Pergande gar vor, „üble Rassentheorien“ gepflegt zu haben.[11] Handelt es sich also bei Kant tatsächlich nur um einen weiteren Fall der von Adorno und Horkheimer bereits 1947 festgestellten „Dialektik der Aufklärung“?
Zu fragen ist vor dem Hintergrund der aktuellen postkolonialen Debatte in der Tat, was der Königsberger von den Rassentheorien seiner Zeit hielt – ob er am Ende gar die Sklaverei befürwortete oder für die europäische Landnahme im Süden der Welt eintrat, also schlicht ein Kolonialist war.
Der Idealist als »Lamarckist«
Tatsächlich lesen wir in Kants 1775 publizierten Schrift „Von den verschiedenen Rassen der Menschen“ den bemerkenswerten Satz: „und kurz, es entspringt der Neger, der seinem Klima wohl angemessen, nämlich stark, fleischig, gelenk, aber unter der reichlichen Versorgung seines Mutterlandes faul, weichlich und tändelnd ist.“[12] Damals ging Kant von einer weißen „Stammgattung“ („Weiße von brünetter Farbe“) aus, die sich in unterschiedlichen Klimazonen und durch „Vermischung“ in vier „Rassen“ ausdifferenzierte, 1.: „Hochblonde (Nordl. Eur.)“[…] von feuchter Kälte“; 2.: „Kupferrote (Amerik.) von trockner Kälte“; 3: „Schwarze“ (Senegambia) von feuchter Hitze sowie 4.: „Olivengelbe (Indianer) von trockner Hitze“.[13]
Gleichwohl erweist sich Kant – so übel diese Sätze heute auch klingen mögen – in der Wissenschaftssprache des 19. Jahrhunderts immerhin doch als „Lamarckist“, das heißt als jemand, der davon ausgeht, dass die Eigenschaften von menschlichen Großgruppen eben nicht in deren Genen liegen, sondern durch die klimatischen Umstände geschaffen werden. So bleibt vor allem die Frage, wie sich Kant zur europäischen Landnahme in Übersee, also zu dem, was heute als Kolonialismus bezeichnet wird, verhalten hat. Hier geht die in den vergangenen Jahren lebhaft geführte angelsächsische Debatte von einem Lernprozess des Königsbergers aus.[14] In „Zum ewigen Frieden“, 1795 als eines seiner Alterswerke erschienen, spricht er sich jedenfalls klar gegen alle Formen der Landnahme aus: Zwar plädiert er für ein Gast- oder „Hospitalitätsrecht“ als „die Befugnis der fremden Ankömmlinge“, das sich aber nicht weiter erstreckt als auf die Bedingungen der Möglichkeit, einen Verkehr mit den alten Einwohnern zu versuchen.[15] Dabei ging er nicht zuletzt mit den sogenannten gesitteten handeltreibenden Staaten Europas streng ins Gericht, gehe doch „die Ungerechtigkeit, die sie in dem Besuche fremder Länder und Völker beweisen, bis zum Erschrecken weit.“[16]
Hier deutet sich bereits an, wie Kant zu einem Vordenker der Vereinten Nationen werden konnte. Tatsächlich stellte er – als ein Mensch des Ancien Régime – die nötigen begrifflichen Mittel bereit, um sowohl die Gründung von Nationalstaaten begreiflich zu machen als auch die Idee einer politischen Weltgemeinschaft zu entwerfen – sei es doch „ein Grundsatz der moralischen Politik: daß sich ein Volk zu einem Staat nach den alleinigen Rechtsbegriffen der Freiheit und Gleichheit vereinigen solle.“[17]
So fordert der erste „Definitivartikel“ zum „Ewigen Frieden“,[18] dass die bürgerliche Verfassung jeden Staates republikanisch sein soll, der zweite, dass das Völkerrecht auf einem Föderalismus freier, das heißt republikanischer Staaten gegründet werde, während der dritte „Definitivartikel“ ein „Weltbürgerrecht auf Hospitalität“ postuliert, dessen Aktualität als globales Gastrecht die desaströse Lage in Moria und andernorts täglich demonstriert.
Am Ende seiner Ausführungen – und das zeigt die erstaunliche Aktualität seiner Friedensschrift – hegt Kant eine Zukunftsvision: „Da es nun unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.“[19]
Dieses Weltbürgerrecht aber setzt eine Rechts- und Menschenrechtskultur voraus, die besagt, „daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird“[20] – eine Maßgabe, die ohne Weiteres mit den global geltenden Menschenrechten im Sinne zwingenden Völkerrechts, des ius cogens, in eins zu setzen ist. Das bedeutet, dass die Mitgliedschaft in einem nur begrenzten republikanischen Staatsbürgerverband nur als Vorgriff auf ein allgemeines Weltbürgerrecht zu denken ist. Demnach qualifiziert der auch nur temporäre Aufenthalt in einem Staatsbürgerverband den Besucher bereits als Rechtssubjekt und enthält somit die Anerkennung, die die Rechtsgenossen einer Republik als solche einander schulden, auch den Mitgliedern anderer Staatsverbände im Vorgriff auf das Weltbürgerrecht gilt. Mit dieser republikanischen Form des Universalismus ist und bleibt Kant ein entscheidender Wegbereiter der UN-Charta und der ihr folgenden Menschenrechtserklärung – ungeachtet seiner aus postkolonialer Sicht teilweise durchaus bedenklichen Einlassungen.
Mit »Tianxia« gegen Kant – und gegen Habermas
Der weitaus radikalere Angriff auf den menschenrechtlichen Universalismus stammt jedoch aus dem globalen Osten. Vor diesem Hintergrund soll im Sinne der anfangs zitierten Überzeugung Hegels gezeigt werden, welche philosophischen Züge die sich anbahnende globale Auseinandersetzung zwischen dem noch liberalen Westen sowie der nicht mehr nur aufstrebenden, sondern bereits etablierten autoritären Weltgroßmacht China angenommen hat.
Ebenfalls in diesem Jahr erschien die grundsätzliche Studie eines der derzeit bekanntesten chinesischen Philosophen, Zhao Tingyang, der 1961 geboren ist und an der chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking lehrt. Sein soeben auf Deutsch erschienenes Buch „Alles unter dem Himmel. Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung“ geht von der „Welt als politischem Subjekt“ aus – und entnimmt seine Begriffe dem von ihm ausführlich dargestellten „Tianxia“-Konzept, das er zunächst im Unterschied zum Demokratiemodell der griechischen Polis entfaltet.[21]
Damit will Tingyang zeigen, dass erst dieser klassische chinesische Begriff einen wahren, menschheitlichen Universalismus ermöglicht: „Der im Konzept des Tianxia anvisierte neue Ausgangspunkt des Politischen etabliert durch die Inklusion der Welt die Welt als politisches Subjekt der Politik und schafft eine Weltsouveränität, an der alle Menschen teilhaben. Er bewirkt, dass sich eine Welt, worin sich alle feindlich gegenüberstehen, zum gemeinsam geteilten ‚Alles unter dem Himmel‘ wird. Der berühmte Satz ‚Das Tianxia gehört allen‘ muss gelesen werden als: Das Tianxia ist das gemeinsam geteilte Tianxia aller Menschen unter dem Himmel.“[22] Das bedeutet nach Auffassung von Zhao Tingyang nicht weniger, als dass dieses System „umfassend günstige Voraussetzungen für das Gemeinwohl, die Nutzenteilhabe und die öffentlichen Angelegenheiten aller Staaten“ zu entwickeln vermag.
Tingyang gibt zu, dass Kant die tödliche Bedrohung der Menschheit durch Kriege erkannt habe, wendet indes ein, dass sich in Kants Friedensschrift realistische Überlegungen mit idealistischen Illusionen mischen. Zwar ist ihm bekannt, dass Kant gegen einen „Weltstaat“ argumentiert, gleichwohl kritisiert er, dass Kant nicht verstanden habe, dass seine Vorschläge lediglich für Gebiete mit gleichartiger Kultur taugen. Gegenüber im Zuge der Globalisierung neu auftretenden Konflikten – wie den Widersprüchen zwischen China und den USA – bleibe Kants Programm wirkungslos, stelle es doch nicht mehr als den Rahmen für internationale Vereinbarungen zwischen Staaten dar, aber „kein System, worin das gemeinsame Interesse mehr Gewicht besitzt als die Interessen der einzelnen Staaten.“[23]
Nicht weniger skeptisch als gegenüber Kant ist Zhao Tingyang gegenüber der Diskursethik von Jürgen Habermas. Er sieht dessen Fehler nicht nur in dem angeblichen utopischen Charakter seiner Ethik, „sondern darin, dass er ein grundlegendes Problem übersieht: Angelegenheiten, die essentielle Daseinsinteressen berühren, lassen keinen Raum für Verhandlungen, gleichgültig wie rational der Diskurs geführt wird.“[24]
Es ist kein Zufall, dass speziell Jürgen Habermas vor allem in China scharf kritisiert wird, tritt doch der aktuelle Universalismus heute vor allem in Gestalt seiner Person wie auch seiner Diskurs-Philosophie auf. Habermas wird inzwischen – was eine gerechte innerstaatliche sowie globale Ordnung betrifft – in so gut wie allen Ländern der Welt ebenso zum Kronzeugen aufgerufen wie seit jeher Immanuel Kant. Davon zeugt unter anderem ein im vergangenen Jahr unter dem Titel „Habermas global“ erschienener Sammelband.[25] Diese immense Ausstrahlung gilt nicht zuletzt für die innerchinesische Debatte: Angesichts des in der Volksrepublik geführten postmaoistischen Diskurses fungiert der Begriff „Habeimasi“ als Zeichen für eine Anzahl von Ideen, die als größtenteils förderlich für Chinas Modernisierung und Demokratisierung angesehen werden.[26] Habermas selbst war stets bemüht, auch im ostasiatischen Raum zu wirken – so hielt er 1996 in Südkoreas Hauptstadt Seoul eine Vorlesung über Kants Friedensschrift und setzte sich mit den Werten des Konfuzianismus sowie des Buddhismus auseinander.[27] In seinem jüngsten Werk „Auch eine Geschichte der Philosophie“ befasst er sich ebenfalls vergleichsweise ausführlich mit dem Denken Ostasiens.[28]
Ein ostasiatischer Philosoph stellt dazu fest: „Eine Möglichkeit wäre, die globale Aufmerksamkeit, die Habermas zukommt, daraufhin zu untersuchen, wie sie sich mit den Schlüsselbegriffen seiner Theorie [des kommunikativen Handelns, M.B.] verbindet, nicht als Folge der Rezeption, sondern vor allem entlang der speziellen intellektuellen Entwicklungswege nichtwestlicher Länder. Das ist es, was wir in einem kosmopolitischen Zeitalter ‚global‘ nennen.“[29]
Auch Zhao Tingyang plädiert – gegen Kant und Habermas – durchaus für eine universale Weltordnung, die allerdings primär allseitige Nutzenteilhabe garantiert, also ein neues „Tianxia“, das die klassische Moderne ablöst und – vor allem – Egoismus und Maximierung des je eigenen staatlichen Nutzens ausschließen soll. Wie andere Autoren ist auch dieser Autor der Auffassung, dass die moderne Demokratie zur bloßen Außenhülle einer Diktatur von Interessen geworden sei, mit anderen Worten, dass hinter dem Individualismus der liberalen Demokratie nichts anderes als nationales Eigeninteresse steht. Welche Züge indes das von ihm geforderte neue „Tianxia“-System als einer den Staaten „übergeordneten universalen Weltordnung“[30] tragen soll, wird nicht wirklich klar: Im Kern geht es jedoch ganz offenbar um ein System umfassender materieller Hilfeleistungen, aber eben nicht um individuelle Freiheit und Demokratie – also im Ergebnis doch um ein letzthin autoritäres, weltweit reziprokes Wohlfahrtssystem.

Foto: Gilles Sabrie / DER SPIEGEL
China als Vorbild – Hongkong zum Trotz
Die Skepsis gegenüber Immanuel Kants kosmopolitischem Weltbürgerrecht wird schließlich auch von einem anderen chinesischen Philosophen in seinem (bisher nur auf Englisch) publizierten neuen Buch[31] deutlich gemacht. Xu Changfu hält Kant vor, die globalisierende Macht des Kapitals noch nicht gesehen zu haben: „Kant sah allerdings nicht voraus, dass nicht die Menschen, sondern das Kapital bei der Erlangung des kosmopolitischen Rechts führend sein würde.“[32]
Auch dieser Autor schweigt sich über die mögliche politische Form einer Lösung dieses Problem aus und votiert für die gegenwärtige Volksrepublik China als Vorbild – und das sogar vor dem Hintergrund der aktuellen Demokratiebewegung in Hongkong und den neuen, Hongkong oktroyierten Sicherheitsgesetzen: „In seinem Bestreben, eine ausgewogene Interaktion zwischen den beiden Seiten der Globalisierung zu schaffen, darf von China – als einem großen Land mit einer uralten humanistischen Tradition und bereichert von Marx‘ humanistischen Idealen – ein Beitrag zur allmählichen Verwirklichung des Zustandes erwartet werden, in dem die globalisierte Arbeiterschaft als ein Zweck aufsteigt, während das globalisierte Kapital als ein Mittel absteigt und der globalisierte Mensch die globalisierten Angelegenheiten meistert.“[33] Wenn also Philosophie tatsächlich ihre Zeit in Gedanken gefasst ist, so steht die Weltgemeinschaft derzeit vor zwei radikal differenten Universalismen: einem Universalismus der Würde, Anerkennung, Demokratie, der individuellen Freiheit und Gerechtigkeit auf der einen und einem Universalismus der Wohlfahrt, der bloß materiellen Zufriedenheit sowie zwischenstaatlicher Hilfe auf der anderen Seite.
Es ist alles andere als ein Zufall, dass bei den Apologeten dieses neuen, nicht demokratischen Universalismus das Denken Carl Schmitts auf wachsendes Interesse, ja sogar immer größere Zustimmung stößt – und zwar nicht zuletzt in der Volksrepublik China.
Peking fasziniert von Carl Schmitt
Der Politologe Mark Lilla – er lehrt politische Ideengeschichte an der Columbia-Universität in New York und ist selbst stark von konservativen Philosophen wie Carl Schmitt oder Leo Strauss geprägt – berichtete bereits vor etwas mehr als zehn Jahren von der Faszination chinesischer Studierender und Intellektueller an dieser Richtung politischen Denkens.[34] Lilla fiel nicht nur bei den eigenen Hörerinnen und Hörern, sondern auch bei seinen späteren Besuchen in China auf, dass deren Interesse weniger der englischsprachigen, im weitesten Sinne liberalen Kultur galt, sondern zunehmend mehr der politischen Philosophie des alten Europa, einschließlich der alten Sprachen, des Griechischen und Lateinischen.
Insbesondere Carl Schmitts Überzeugung, dass es keine liberale Politik, sondern allenfalls eine liberale Kritik der Politik gäbe, findet in China sogar unter Personen großen Anklang, die der Staatspartei eher fernstehen. Lilla stellt fest, dass angesichts der weit gestreuten Unzufriedenheit mit Chinas ökonomischer Modernisierung und der damit einhergehenden Annahme, dass diese Modernisierung doch stark vom Neoliberalismus beeinflusst sei, die Ideen von Carl Schmitt nicht nur klug, sondern geradezu prophetisch wirken: „Den Linken erklärt er ohne Berufung auf den Marxismus, warum die Unterscheidung zwischen Wirtschaft und Politik falsch und schädlich ist – und wie der Liberalismus als eine Ideologie funktioniert, die zentrale Phänomene des politischen Lebens ignoriert oder wegdefiniert. Seine Idee der Souveränität, die durch Ermächtigung etabliert und von einer verborgenen Ideologie unterstützt wird, hilft der Linken auch zu verstehen, welch merkwürdigen Zugriff neoliberale Ideen heute auf so viele Leute haben. Und sie gibt ihnen Hoffnung, dass etwas – eine Katastrophe? ein Putsch? eine Revolution? – den chinesischen Staat auf ein Fundament stellen könnte, das weder konfuzianisch noch maoistisch, noch kapitalistisch ist. Hier“ – und damit schließt Lilla – „kommt der Zauber ins Spiel.“[35]
Tatsächlich ist einer der führenden Philosophen des heutigen China, der 1956 geborene Liu Xiaofeng, ein zwar hoch umstrittener, jedoch herausragender Kenner der Arbeiten sowohl von Carl Schmitt als auch des konservativen Vordenkers Leo Strauss.[36] Desgleichen bezieht sich auch Zhao Tingyang auf Carl Schmitt, wenn er, in freilich ambivalenter Weise, feststellt, dass das Wesen der Welt sich nicht durch ihre Größe, sondern durch ihren Reichtum an Vielfalt auszeichnet – eine Einsicht, die wiederum im Einklang mit der Lehre des Tianxia steht: „Wenn die Schöpfung einheitlich wäre, würden alle Geschöpfe zu einem Geschöpf, quasi zu Kopien eines Geschöpfes. Nur die Diversität der Geschöpfe schafft Eintracht bzw. Kompatibilität, nur dann entsteht Welt. Wird die Welt zu einer Religion, zu einem Wertesystem, zu einer Geisteswelt vereinheitlicht, schrumpft sie in geistiger Hinsicht zu einem Wesen zusammen und hört auf, Welt zu sein, mag sie räumlich auch noch so groß sein.“[37]
Diese Weltkonzeption entspricht exakt derjenigen Carl Schmitts: Der von Tingyang wie von Schmitt abgelehnten Idee des allen gemeinsamen einheitlichen Universums mit potentiell gleichen Rechten für alle Menschen stellt Schmitt in seiner „Großraumordnung“ das Pluriversum unterschiedlicher Großmächte gegenüber, die ihre je eigenen Wertvorstellungen mit dem Interventionsverbot gegen andere Großmächte und den liberalen Menschenrechtsinterventionismus („Wer Menschheit sagt, will betrügen“) zu verteidigen berechtigt sind.
Feind versus Freund statt Menschenrechtsuniversalismus
In seiner späten Schrift „Der Nomos der Erde“[38] setzt sich Schmitt kritisch mit Kants Begriff des „ungerechten Feindes“[39] auseinander, um zu vermuten, dass es im Krieg gegen einen solchen Feind darum gehen könnte, dass „die im Gleichgewicht zum Ausdruck kommende Raumordnung selbst bedroht“[40] werde – eine Interpretation, die der auch vom „Tianxia“ geforderten globalen Koexistenz verschiedener politischer Systeme entspricht. Auch das ist kein Zufall: Tatsächlich war Carl Schmitt vergleichsweise früh mit dem Gedankengut der chinesischen Revolution vertraut. In seiner 1963 erstmals erschienen Schrift „Theorie des Partisanen“ zitiert er zustimmend ein ins Deutsche übersetztes Gedicht Mao Tse-Tungs: „Wär mir der Himmel ein Standort, ich zöge mein Schwert / Und schlüge dich in drei Stücke / Eins als Geschenk für Europa, Eins für Amerika / Eins aber behaltend für China / Und es würde Frieden beherrschen die Welt.“[41]
Anders als die maoistischen Kleinstparteien der 1960er und 1970er Jahre postuliert dieses Gedicht nämlich nicht eine überall in Gang zu setzende Weltrevolution, sondern einen raumbezogenen Frieden – geradeso wie das auch die von Zhao Tingyang wiederbelebte Tradition des „Tianxia“ es fordert.
Damit ist zum Ende noch einmal die Frage nach der Rezeption des westlichen Universalismus in China zu stellen. Hegel jedenfalls wurde lange als Hintergrund des dominanten marxistischen Denkens rezitiert, obwohl er selbst der chinesischen Kultur nicht viel zubilligte, wie soeben Gang Xian in der „Zeitschrift für Ideengeschichte“ vermerkt hat.[42]
Kulturrelativismus ist keine vernünftige politische Option
Was Immanuel Kant anbelangt, war es vor allem Mou Zongsan (1909-1995), der den Versuch unternommen hat, Kants Philosophie in Einklang mit dem klassischen konfuzianischen Denken zu bringen.[43] Allerdings erweist sich dabei, dass die chinesische Rezeption der Kantschen Werke immer schon Ausdruck eines Willens zu auch individueller Freiheit und Republik war – im Gegensatz zu einem nur auf Tugend basierenden, wohlfahrtlichen, aber nicht demokratischen Staat. Für diese, in sich widersprüchliche Rezeption Kants steht etwa der Dichter und Philosoph Wang Guowei (1877-1927), der sich als Professor in Peking das Leben nahm, als die revolutionäre kommunistische Armee im Bürgerkrieg die Stadt eroberte.[44]
Heute geht es, auf die globalisierte Welt bezogen, tatsächlich um das, was nur oberflächlich als „Liberalismus“ bezeichnet wird, aber etwas weit Umfassenderes, eben Menschenrechtsuniversalismus meint – und gerade deshalb so massiv unter Druck steht: „Die praktische Klugheit zu betonen, heißt, die Globalisierung vom Dogma des Liberalismus zu befreien und den grundlegenden Rechten der Menschen in den Entwicklungsländern zu dienen“, schreibt Xu Changfu, und weiter heißt es bei ihm: „Arme Menschen haben das Recht, nach ihrem eigenen Verständnis und ihrer eigenen Urteilskraft zu verfahren, und ihnen sollte keine Theorie auferlegt werden, sei es der Marxismus oder der Liberalismus.“[45]
Sofern „Liberalismus“ mehr ist als nur Marktradikalismus, ist das inakzeptabel: Der Kampf gegen die Armut berechtigt nicht dazu, republikanische Freiheiten und Menschenrechte zu suspendieren. Kulturrelativismus dieser Art, daran gilt es festzuhalten, ist und bleibt keine vernünftige politische Option – so sehr die aufstrebenden Mächte auch darauf drängen.
(Quelle: »Blätter« 10/2020, S. 81-90 / www.spiegel.de / wikipedia.org)
[1] Vgl. Klaus Vieweg, Die Revolution der Freiheit: 250 Jahre Hegel, in: „Blätter“, 8/2020, S. 109-120.
[2] Vgl. etwa Tongdon Bai, Against Political Equality. The Confucian Case, Princeton 2019.
[3] So die streitbare Analyse von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg, die soeben unter dem Titel „Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet“ erschienen ist (München 2020).
[4] Ich zitiere im Folgenden Kants Friedensschrift nach der 1984 im Reclam Verlag Stuttgart erschienen Ausgabe.
[5] Konstantin Pollok, Wann beginnt die Ewigkeit? Die Vereinten Nationen im Lichte Immanuel Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“, 1996.
[6] Immanuel Kant, Gesammelte Werke, Bd. 9, Darmstadt 1970, S. 53.
[7] Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Frankfurt a. M. 2007, S. 52.
[8] Pico della Mirandola, Über die Würde des Menschen, Zürich 1988.
[9] Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, a.a.O., S. 69.
[10] Ebd., S. 71.
[11] „Tagesspiegel“ bzw. „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“, beide vom 21.6.2020.
[12] Immanuel Kant, Von den verschiedenen Rassen der Menschen, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 9, Darmstadt 1970, S. 23.
[13] Ebd., S. 28
[14] Seyla Benhabib, (Hg.) Kosmopolitismus und Demokratie. Eine Debatte, Frankfurt a. M./New York 2008; Thomas Mc Carthy, Race, Empire and the Idea of Human Development, Cambridge 2009; Katrin Flikschuh und Lea Ypi (Hg.), Kant and Colonialism, Oxford 2014; Pauline Kleingeld, Kant and Cosmopolitanism, Cambridge 2012.
[15] Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, a.a.O., S. 22, vgl. auch Micha Brumlik, Flucht ohne Grenzen. Das Weltbürgerrecht und die Neuvermessung des politischen Raums, in: „Blätter“, 9/2017, S. 71-78.
[16] Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, a.a.O.
[17] Immanuel Kant, in: ders., Akademieausgabe VIII, S. 378.
[18] Vgl. hierzu: Ottfried Höffe (Hg.), Klassiker Auslegen: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, Berlin 2002.
[19] Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, a.a.O., S. 24.
[20] Ebd.
[21] Ohne die Hinweise der derzeit in Berlin wirkenden Philosophin Dr. Wang Ge hätten die folgenden Ausführungen nicht geschrieben werden können. Ihr gilt mein Dank.
[22] Zhao Tingyang, Alles unter dem Himmel. Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung, Berlin 2020, S. 48 f.
[23] Ebd., S. 191.
[24] Ebd., S. 193.
[25] Luca Corchia, Stefan Müller-Doohm und William Outhwaite (Hg.) Habermas global. Wirkungsgeschichte eines Werks, Berlin 2019. Auf beinahe 900 Seiten – einschließlich einer von dem Habermasbiographen Stefan Müller-Dohm und Dorothee Zucca verfassten Einleitung – wird die Rezeption dieses Werks nicht nur in Europa, sondern auch in Lateinamerika, einschließlich Brasiliens, in Japan, Indien sowie – last but not least – in Vietnam und China behandelt.
[26] Gloria Davies, Habermas in China: Theorie als Katalysator, in: Luca Corchia, Stefan Müller-Doohm und William Outhwaite (Hg.), a.a.O., S. 687-714, hier: S. 688-691.
[27] Sang-Jin Han, Habermas in Ostasien, in: Luca Corchia, Stefan Müller-Doohm und William Outhwaite (Hg.), a.a.O., S. 733.
[28] Jürgen Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, Bd. 1, Berlin 2019, S. 361-405; vgl. dazu auch meine ausführliche Besprechung: Vom Nutzen und Vorteil der Religion für die Vernunft. Wie Jürgen Habermas die Geschichte der Philosophie deutet, in: „Blätter“, 2/2020, S. 112-120.
[29] Sang-Jin Han, Habermas in Ostasien, a.a.O., S. 737.
[30] Zhao Tingyang, a.a.O., S. 227.
[31] Xu Changfu, Marxism, China and Globalization. Revised Edition, Berlin 2019.
[32] Ebd., S. 136.
[33] Ebd., S. 146 f.
[34] Mark Lilla, Reading Strauss in Bejing, in: „The New Republic“, 17.12.2010.
[35] Ebd.
[36] Kai Marchal und Carl K. Y. Shaw (Hg.), Carl Schmitt and Leo Strauss in the Chinese-speaking World: Reorienting the Political, Lanham 2017.
[37] Zhao Tingyang, a.a.O., S. 201.
[38] Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin 1974.
[39] Ebd., S. 140-143.
[40] Ebd., S. 143.
[41] Ebd., S. 63.
[42] Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, S. 124 f.
[43] Jana S. Rošker, Mou Zongsan’s Negation of the Moral Self: A new Dialectical Model?, Mou Zongsans Werk gilt ein aufschlussreicher Eintrag in der „Internet Encyclopedia of Philosophy“.
[44] Joey Bonner, Wang Kuo-wie: An intellectual biography, Cambridge 1986.
[45] Xu Changfu, a.a.O., S. 124.