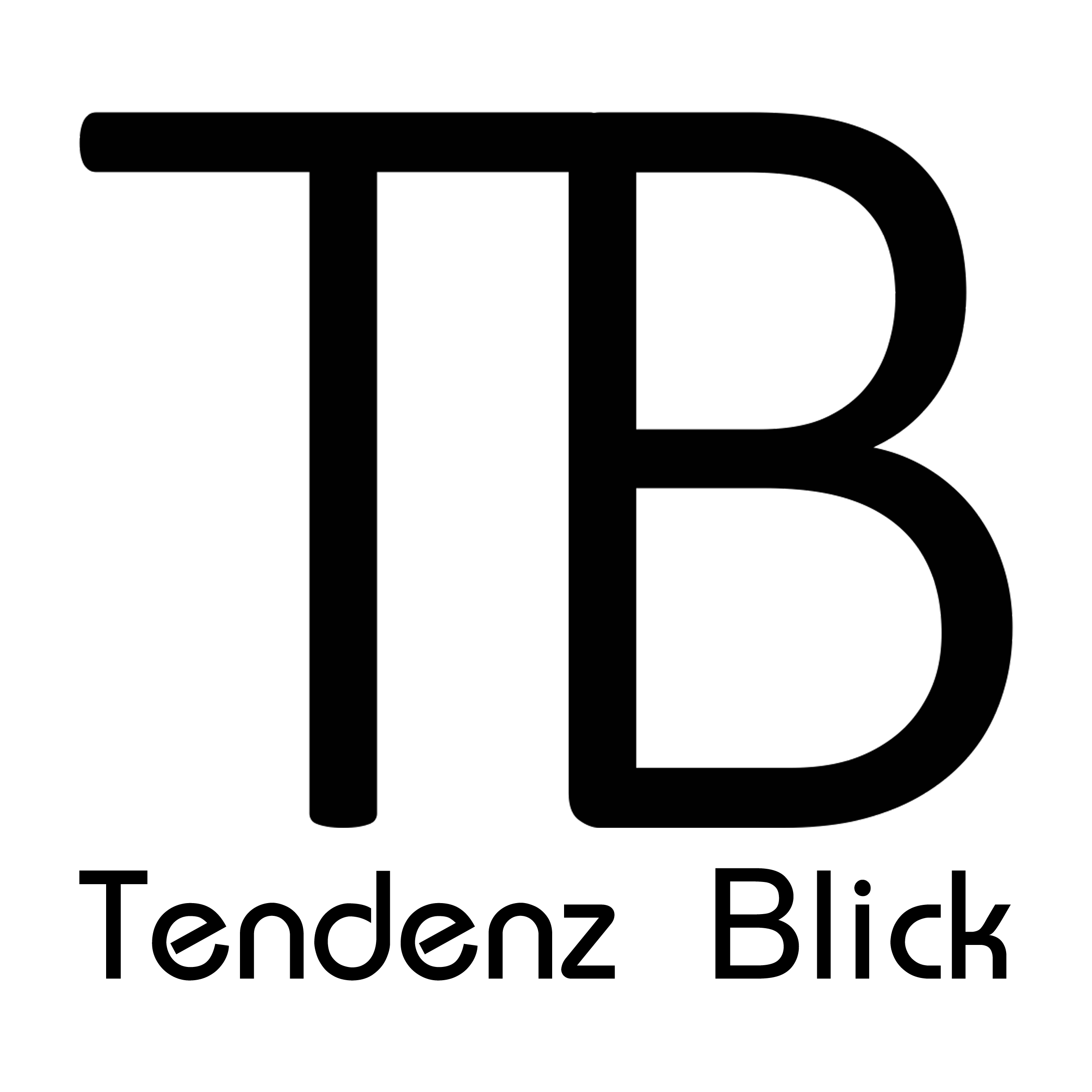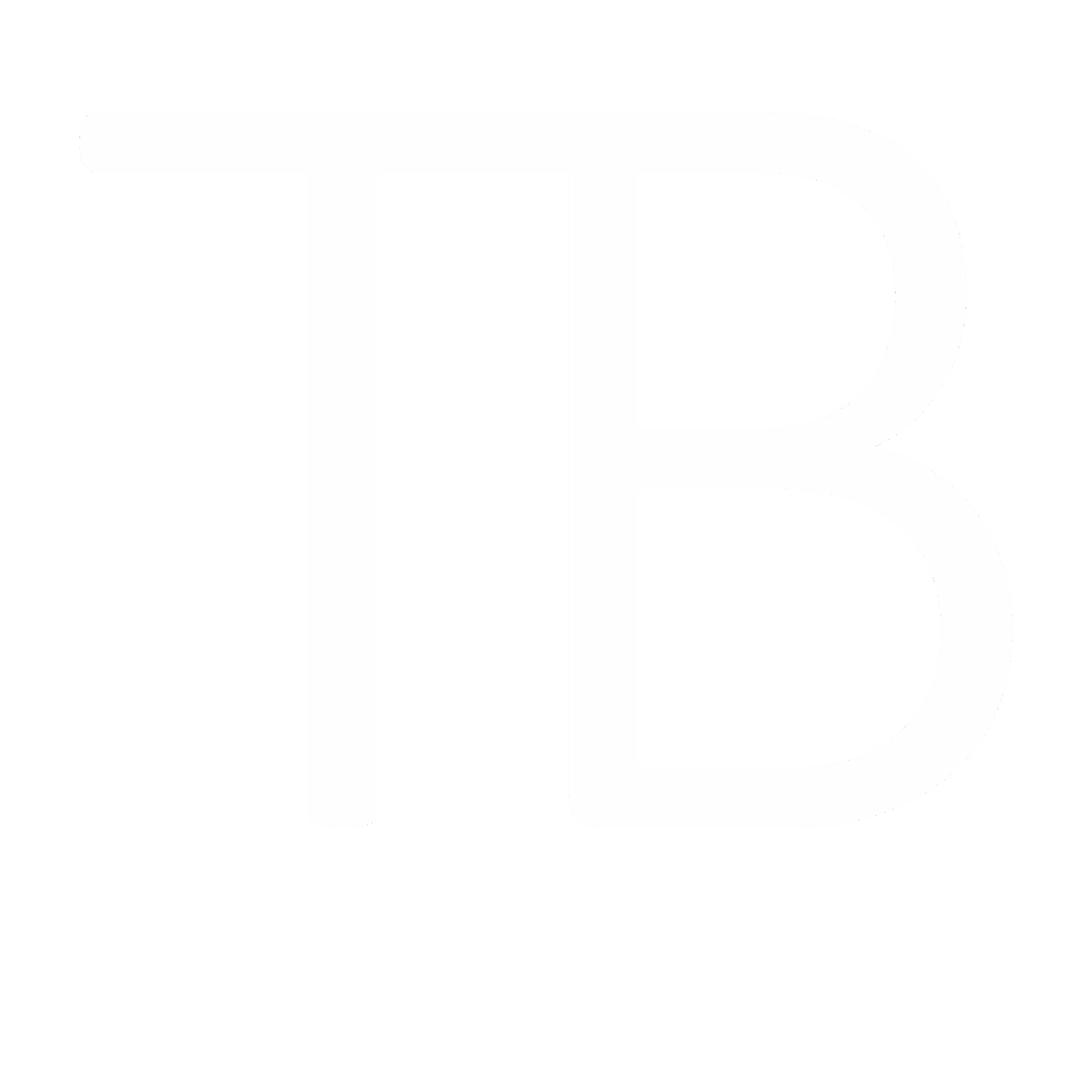Warum westliche Forschende unbedingt weiter nach China fahren sollten: Nur der direkte Austausch mit Wissenschaftler:innen vor Ort ermöglicht ein vollständiges Bild dieser komplexen und vielfältigen Gesellschaft.
Thorsten Benner greift in seinem Meinungsbeitrag im Tagesspiegel vom 11. Mai eine sehr wichtige Frage in Bezug auf China auf. Soll man als Wissenschaftler:in noch zu Forschungszwecken in ein Land reisen, dessen innenpolitische Kontrolle sich in den letzten Jahren signifikant verschärft hat? Soll man noch in einem Land Feldforschung betreiben, in dem Ausländer:innen nicht mehr automatisch privilegiert und von vielen Strafen ausgenommen sind (wie es früher einmal üblich war)? Und soll man den Austausch mit Wissenschaftler:innen in einem Land aufrechterhalten, auch wenn man aufpassen muss, seine Gesprächspartner nicht durch unbedachte Äußerungen in Schwierigkeiten zu bringen? Die Antwort ist: Ja, unbedingt! Und zwar aus folgenden Gründen:
1. Chinaforschung kann nicht allein basierend auf Internetrecherchen und mit Reisen nach Taiwan betrieben werden. Die Volksrepublik China ist viel zu groß, ihre Gesellschaft viel zu komplex, die politischen Entwicklungen viel zu rasant und disruptiv, um sie allein von außen zu betrachten. Es ist notwendig, vor Ort zu recherchieren und die Ergebnisse zu interpretieren – am besten vor dem Hintergrund langjähriger Chinaerfahrung. Man muss mit den Leuten reden. Man muss hören, wie sie die Dinge sehen, welche Ergebnisse die dortige Forschung hervorbringt und wie dort gesellschaftliche und politische Entwicklungen begründet werden. Das heißt nicht, sich die chinesischen Interpretationen und Erläuterungen zu eigen zu machen. Aber die wissenschaftliche Redlichkeit gebietet es, sich ein vollständiges Bild zu machen. Übrigens sind Chinesischkenntnisse hierfür durchaus hilfreich, denn nur ein Bruchteil der Informationen über China – auch im Internet – wird in andere Sprachen übersetzt.
2. Chinaforschung ist heute eine empirische Wissenschaft, die nicht mehr nur über, sondern auch mit China betrieben wird. Zur Zeit des Kalten Krieges, als Maos China sich außenpolitisch isolierte, gab es im Prinzip zwei Typen von Sinologie. Der philologische Zweig, in Deutschland stark, wandte sich ab von der Volksrepublik China und konzentrierte sich ganz auf das Studium der klassischen philosophischen Schriften des Altertums. Der andere, regionalwissenschaftliche Zweig, besonders von den USA geprägt, war zwar (aus militärisch-strategischen Gründen) am China der damaligen Zeit interessiert, hatte aber auch keinen direkten Zugang zur abgeschotteten Volksrepublik. Durch die Interpretation von ins Ausland geschmuggelten Dokumenten sowie Fotos und durch Interviews mit Flüchtlingen außerhalb des Landes versuchte die Sinologie zu ergründen, was im Land vor sich ging. Parallel zur “Kreml-Astrologie” über die Sowjetunion entstand zu China die “Zhongnanhaiologie”, die “Lehre über Zhongnanhai”, benannt nach dem chinesischen Regierungssitz in Peking. Diese frühe Form der Politikdeutung war sehr fehleranfällig.
Inzwischen hat sich die Chinaforschung deutlich weiterentwickelt, auch weil das Land sich geöffnet hat. Der geisteswissenschaftliche Zweig ist naturgemäß noch immer vor allem dem Text- und Dokumentenstudium verhaftet. Aber die sozialwissenschaftliche Chinaforschung ist schon längst zu einer stark empirisch geprägten Wissenschaft geworden, die methodisch-theoretisch in der Soziologie, der Politikwissenschaft und der Humangeografie geschult ist. Sie ist keineswegs intellektuell zu simpel (wie manchmal dargestellt) um sich ihr eigenes, kritisches und faktenbasiertes Bild von der Realität in China zu machen. Beide Zweige der Chinaforschung sind spätestens seit den 1980ern durch den intensiven Austausch mit chinesischen Wissenschaftler:innen geprägt. 2021 zählt die Hochschulrektorenkonferenz allein mehr als 1.400 deutsch-chinesische Hochschulkooperationen. Die unzähligen individuellen Forschungsprojekte und -kooperationen, Studienaufenthalte und Dissertationsprojekte mit chinesischen Forschungspartner:innen sind darin noch gar nicht erfasst.

3. Der Austausch mit chinesischen Wissenschaftler:innen und Vor-Ort-Recherchen sind wichtige (Primär-) Informationsquellen über die Weltmacht China, auch jenseits der Wissenschaft, zum Beispiel für politische Entscheider:innen und Wirtschaftsakteure. Die Zahl der ausländischen Journalist:innen in China wurde kürzlich radikal reduziert (übrigens als Antwort auf entsprechendes Vorgehen in den USA unter der Trump-Administration). Die Arbeit politischer Stiftungen dort wurde durch das strenge chinesische NGO-Gesetz von 2017 ebenfalls stark eingeschränkt. Dadurch fehlen uns wichtige Informationsquellen aus erster Hand vor Ort. Wenn jetzt nicht einmal mehr die Wissenschaftler:innen nach China fahren, sind wir komplett auf das Internet und Sekundärliteratur angewiesen. Ein ausgewogenes Chinabild, das dem Pluralismus dieser komplexen und vielfältigen Gesellschaft gerecht wird und die Basis für kluge außenpolitische und ökonomische Entscheidungen sein sollte, ist so nicht mehr herstellbar.
4. Chinaforschung ist, wie Forschung allgemein, ein reziproker Prozess. Der Kontakt zu chinesischen Kolleg:innen ist letztendlich nicht nur eine Informationsfrage für uns, sondern auch für die chinesischen Wissenschaftler:innen dort. Diese mögen ihren eigenen politischen und gesellschaftlichen Zwängen unterliegen, aber sie sind weiterhin am Austausch mit dem Ausland interessiert und offen für neue Ideen, gerade in Zeiten des eingeschränktem Internet- und Medienzugangs. Für westliche Wissenschaftler ist es wichtig, vor Ort in den Bereichen mit chinesischen Kolleg:innen zusammenzuarbeiten, in denen China Spitzenforschung betreibt, beziehungsweise bald betreiben wird. Wissensproduktion ist inzwischen ein globaler und vernetzter Prozess geworden. Würden sich Deutschlands Wissenschaftler wirklich von China isolieren, würde die deutsche Wissenschafts- und Technikentwicklung in vielen Bereichen hart getroffen.
5. Chinaforscher:innen haben, wie andere Regionalwissenschaftler:innen auch, eine Mittlerfunktion. Sie vermitteln nicht nur Informationen, sondern erklären, fördern Verständnis zwischen den Kulturen und Gesellschaften und bauen Vertrauen auf. Das ist ein inkrementeller Prozess, der Jahrzehnte dauert und großes Konfliktlösungspotential hat. Es wäre ein großer Verlust, das soziale und kulturelle Kapital, das über Jahrzehnte der Zusammenarbeit entstanden ist, durch Abbruch oder auch nur Unterbrechung der Wissenschaftskontakte aufs Spiel zu setzen.
Thorsten Benner warnt in seinem Beitrag vor dem Fehler, die von China sanktionierten Forscher:innen, die vorerst nicht mehr nach China reisen können, unter anderem von parlamentarischen Anhörungen oder Expertentreffen auszuschließen. Das ist selbstverständlich richtig. Wenn man sich die Agenden der anstehenden Veranstaltungen ansieht, hat man aber nicht den Eindruck, dass das der Fall ist. In der gegenwärtigen von Entfremdung und Informationsdefiziten geprägten Lage umgekehrt die Chinawissenschaftler:innen zu ignorieren, die weiterhin die Möglichkeit haben, sich vor Ort ein Bild zu machen, wäre jedoch sicher ebenso töricht.
(Quelle: China.Table)