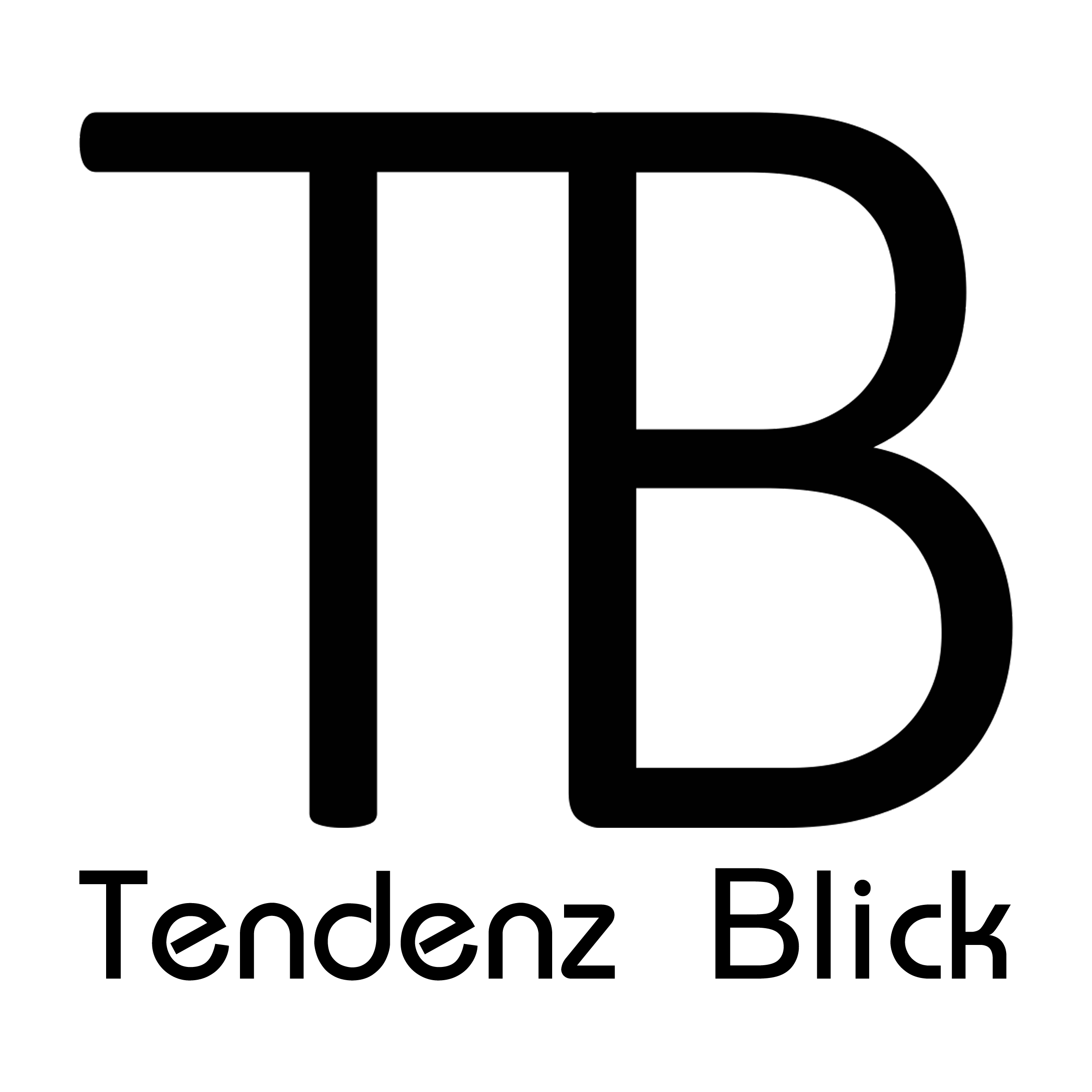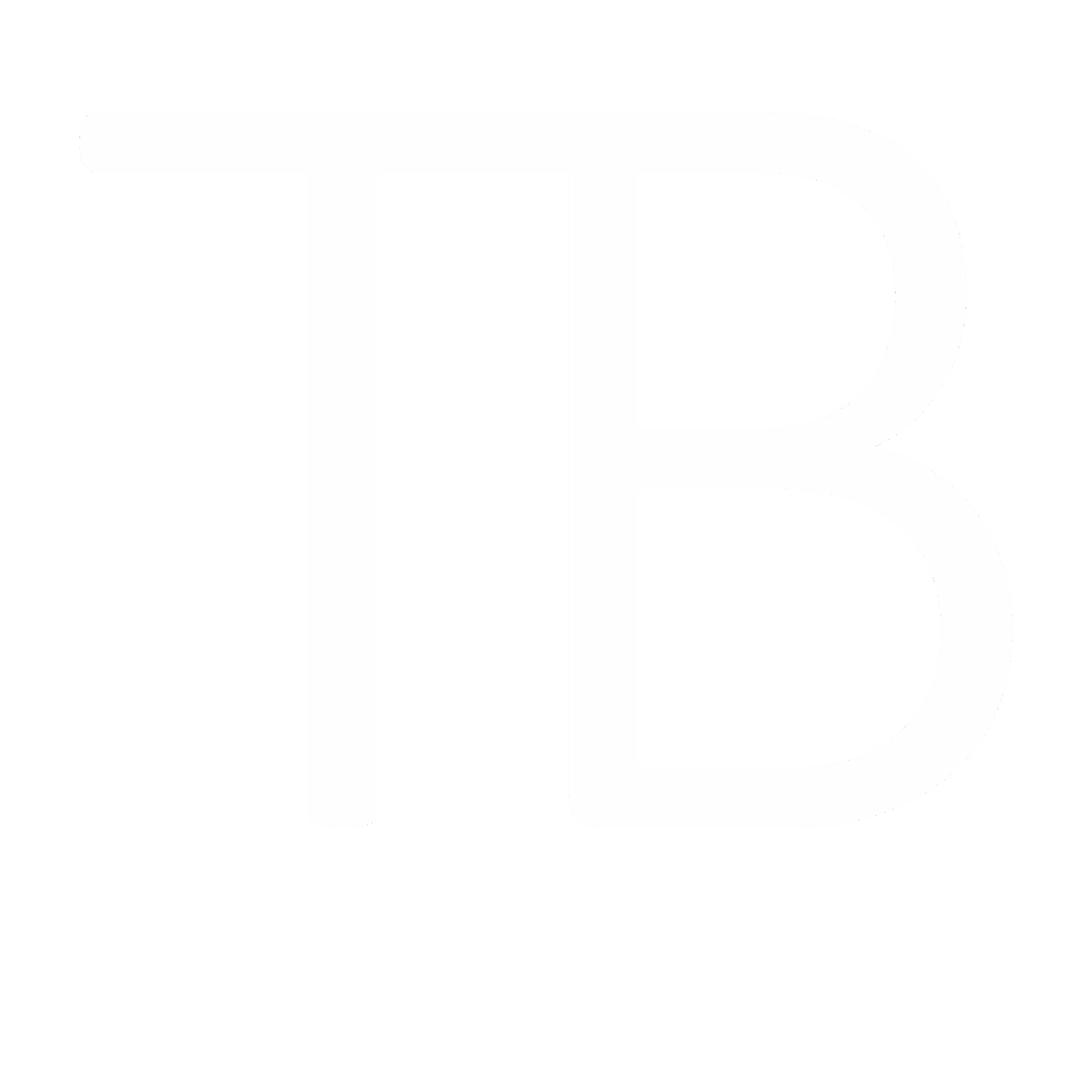China ist seine Heimat geworden, Schöngrabern ist seine Heimat geblieben: Leopold Leeb unterrichtet an der Renmin-Universität in Peking die Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch und verfasste über 50 Bücher; auf Chinesisch, wohlgemerkt. Über die Videotelefonie sprach er mit Elisabeth Hess über die Corona-Situation in China, den Umgang mit Freiheit, und was er an seiner Heimat Österreich vermisst.

NÖN: Wie erleben Sie momentan die Lage in China?
Leopold Leeb: Wahrscheinlich viel ruhiger als in Österreich oder Deutschland, es gibt nur sehr wenig infizierte Personen bei uns – wenn man den offiziellen Zahlen der Medien glauben kann. Das ist unglaublich für eine Milliarde Menschen. Überall sind Kontrollen, die Leute tragen ständig eine Maske. Das ganze Land ist in Zonen eingeteilt.
Wie haben Sie den Anfang der Pandemie erlebt?
Leeb: Das war vor einem Jahr, kurz vor dem chinesischen Neujahr im Februar: Ich war mit Freunden Abendessen, als die Nachricht kam, dass eine mysteriöse Krankheit in Wuhan ausgebrochen sei. Damals wussten wir noch nicht, wie das einzuschätzen ist. Drei Tage später waren schon die Kirchen in Peking geschlossen. Ich war aber nicht furchtsam, weil ich 2003, als SARS ausgebrochen ist, auch schon in Peking war. Damals war der Spuk nach kurzer Zeit vorbei. Ich war zuversichtlich, dass die Behörden das schaffen.
Wie haben Sie den Lockdown verbracht?
Leeb: Ich wohne hier an der Uni, Sie sehen mich im Appartement, das am Unigelände ist, wo ich zehn Minuten zum Vorlesungssaal brauche. Vergangenes Semester war regulärer Unterricht, aber davor habe ich online unterrichtet. Bei allen Eingängen stehen Wächter und seit zwei Jahren gibt es Kameras mit Gesichtserkennung. Dadurch kann man ganz leicht rein- und rausgehen. Die Angestellten der Uni können das Gebäude problemlos verlassen. Derzeit wird den Studenten nicht gestattet, frei die Uni zu verlassen. Sonst bin ich sehr beschäftigt mit Bücher lesen und schreiben sowie dem Unterrichten von Latein, Griechisch und Hebräisch. Das macht mir sehr viel Spaß, daher empfinde ich die Situation nicht als belastend oder beängstigend.
Wie feierten Sie das chinesische Neujahr am 12. Februar?
Leeb: Mit einem anderen katholischen chinesischen Priester, der hier auch studiert und eigentlich zu seiner Familie nach Hause fahren wollte. Mit ihm werde ich Sauerkraut und Würstel essen und einen Wein aus dem Weinviertel trinken. Mit ihm kann ich mich gut unterhalten, weil wir ähnliche Interessen haben, nämlich die chinesische Kirchengeschichte.
Wie oft fahren Sie nach Hause?
Leeb: Ich gehöre zum Orden der Steyler Missionare und da ist es vorgesehen, alle drei Jahre einen Heimaturlaub für drei Monate zu machen. Die letzten Jahre war es immer öfter, weil ich zu Konferenzen nach Deutschland eingeladen wurde. Ich vermute, dass es dieses Jahr nichts werden wird. China ist gefühlsmäßig schon meine Heimat geworden, weil meine Arbeit, Freunde, Studenten und Verlage hier sind.

Das heißt, Sie leben auch zölibatär?
Leeb: Ja, ich habe keine Familie. Das ist sehr überraschend für die Chinesen. Ich muss vorsichtig sein, weil man aufgrund der Religionspolitik in China nicht offiziell sagen darf, dass man religiös ist und einem Orden zugehört. Es darf keine Einflussnahme von außen stattfinden. Ein ausländischer katholischer Priester darf nie öffentlich eine Messe lesen. Es gibt jedoch Ausnahmen, zum Beispiel einen Priester, der in der deutschen Botschaft für deutsche und österreichische Katholiken predigt. Die Religionspolitik ist sehr restriktiv.
Fühlen Sie sich dann nicht in Ihrer Freiheit eingeschränkt?
Leeb: Am Anfang weiß man nicht, wo die Grenzen sind. Nach einigen Jahren ist das klar. Es gibt große Tabuthemen, wie den Tibet, Taiwan oder 1989 am Platz des himmlischen Friedens. Alles, was kritisch ist, ist tabu. Es wird erwartet, dass Ausländer nur Positives sagen, da ja keine Kritik erwünscht ist. Hier kann jede Kritik als Kritik am System ausgelegt werden. Mit den Jahren weiß man, worüber man reden kann und nicht.
Haben Sie aufgrund der Einschränkungen irgendwann überlegt, zurück nach Österreich zu gehen?
Leeb: Ich habe im Vergleich zu den Chinesen viel Freiheit, ich bin zum Beispiel bei keiner Partei. Ich kann auch Vorschläge zu Universitätsvorlesungen machen, das ist auch eine Freiheit. Auch die Sache mit dem Hebräisch-Unterricht war meine Idee. Ich entscheide selbst, was und worüber ich schreibe. Chinesische Professoren sind vielleicht weniger frei. Davon bin ich verschont. Ich genieße eigentlich unglaublich große Freiheit. Wenn man in diesem Rahmen bleibt, den China vorgibt, kann man relativ gut und unbehelligt seine Sachen machen. Mir geht keine Freiheit ab.
Woran schreiben Sie gerade?
Leeb: Ich schreibe gerade ein Buch über die Kirchengeschichte von Vietnam und China. Seit 25 Jahren befasse ich mich mit der chinesischen Kirchengeschichte. Das ist hochinteressant.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in China zu studieren?
Leeb: Mit 18 Jahren habe ich am Missionshaus St. Gabriel Philosophie und Theologie studiert. Im Jahr 1988 gab es die Möglichkeit, in Taiwan ein Sprachstudium zu machen – das war die Entscheidung meines Lebens, da habe ich drei Jahre lang Chinesisch gelernt. Die Schriftzeichen zu lernen, kostet sehr viel Zeit und Energie, damit war die Entscheidung gelaufen, denn wenn ich schon die Sprache gelernt habe, dachte ich, kann ich nur mehr in China oder in Taiwan arbeiten. Ich habe dann in Österreich das Studium abgeschlossen, bin anschließend nach Peking gereist und habe mein Doktorat gemacht. Seit 2004 habe ich meine Anstellung als Professor. Ich bin zu einer kleinen Berühmtheit geworden, der Professor Leo, der die klassischen Sprachen unterrichtet.
Wie schwierig war es, Chinesisch zu lernen?
Leeb: Die chinesische Sprache hat circa 5.000 bis 7.000 Schriftzeichen, die alle sehr verschieden sind in der Aussprache und in der Bedeutung. Die Schriftzeichen sagen oft nichts über die Aussprache aus, das ist reine Gedächtnissache, da braucht man viel Motivation dafür. Es wird mit der Zeit immer besser, weil man sich die Schriftzeichen leichter merkt.
Sie haben auch ein Buch geschrieben mit dem Titel, „Peking, Hauptstadt meiner Seele“. Warum ist es Ihre Seelenheimat?
Leeb: Um aufzuzeigen, dass Peking eine geistige Brücke zwischen China und dem Westen ist, habe ich diese Brücke über die Kirchengeschichte gebaut. In Peking gab es sehr viele hervorragende Sinologen und Missionare, und einige sind hier begraben. Diese Gräber und die Kirchen in Peking sind historisch aufgeladene Orte. Das ist meine geistige Heimat geworden.
Sie sind Philosoph, Theologe, Sinologe, Übersetzer und Professor. Als was davon sehen Sie sich am meisten?
Leeb: Ich bin Linguist und als Zweiteres würde ich sagen, dass ich Kirchenhistoriker bin.
Gehen wir zurück nach Österreich: Sie sind aus Schöngrabern – welche Erinnerungen haben Sie?
Leeb: Meine Schulzeit: Ich war zuerst in der Hauptschule und dann im Gymnasium. Zum Glück habe ich damals schon Latein und Griechisch gelernt, was mir jetzt sehr leichtfällt. Hollabrunn ist ein Stück meine Heimat geblieben.
Was vermissen Sie an Österreich?
Leeb: Den Wein, und zum Teil das Essen. Die schöne Umgebung, die gute Luft, die Vegetation. Peking ist sehr dicht besiedelt und wir haben viel Smog. Aber dafür haben wir auch viel Sonne. Taiwan war sehr wolkig und nass.
(https://m.noen.at/hollabrunn/leben-in-peking-leopold-leeb-mir-geht-keine-freiheit-ab-schoengrabern-redaktionsfeed-interview-leopold-leeb-redaktion-249680879)