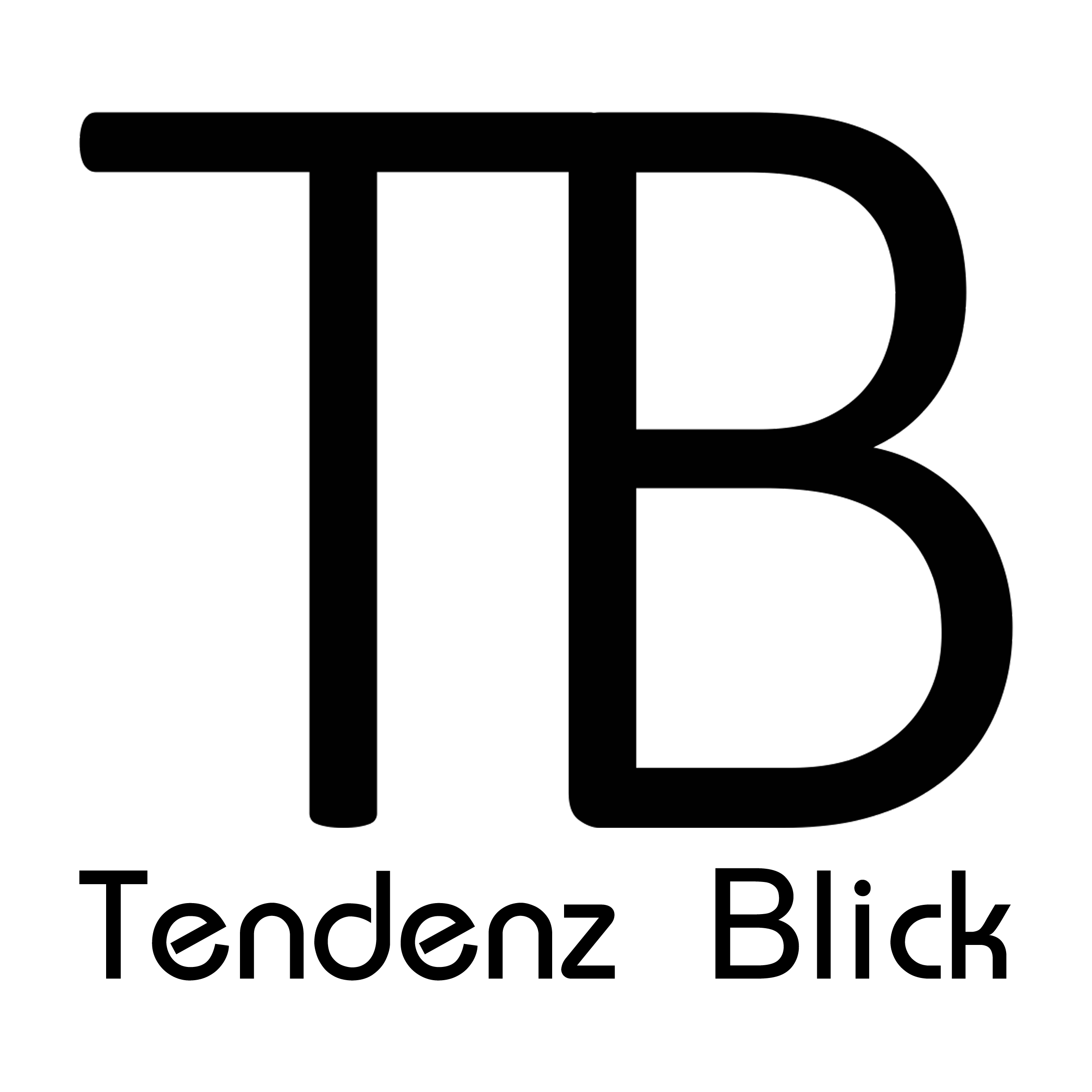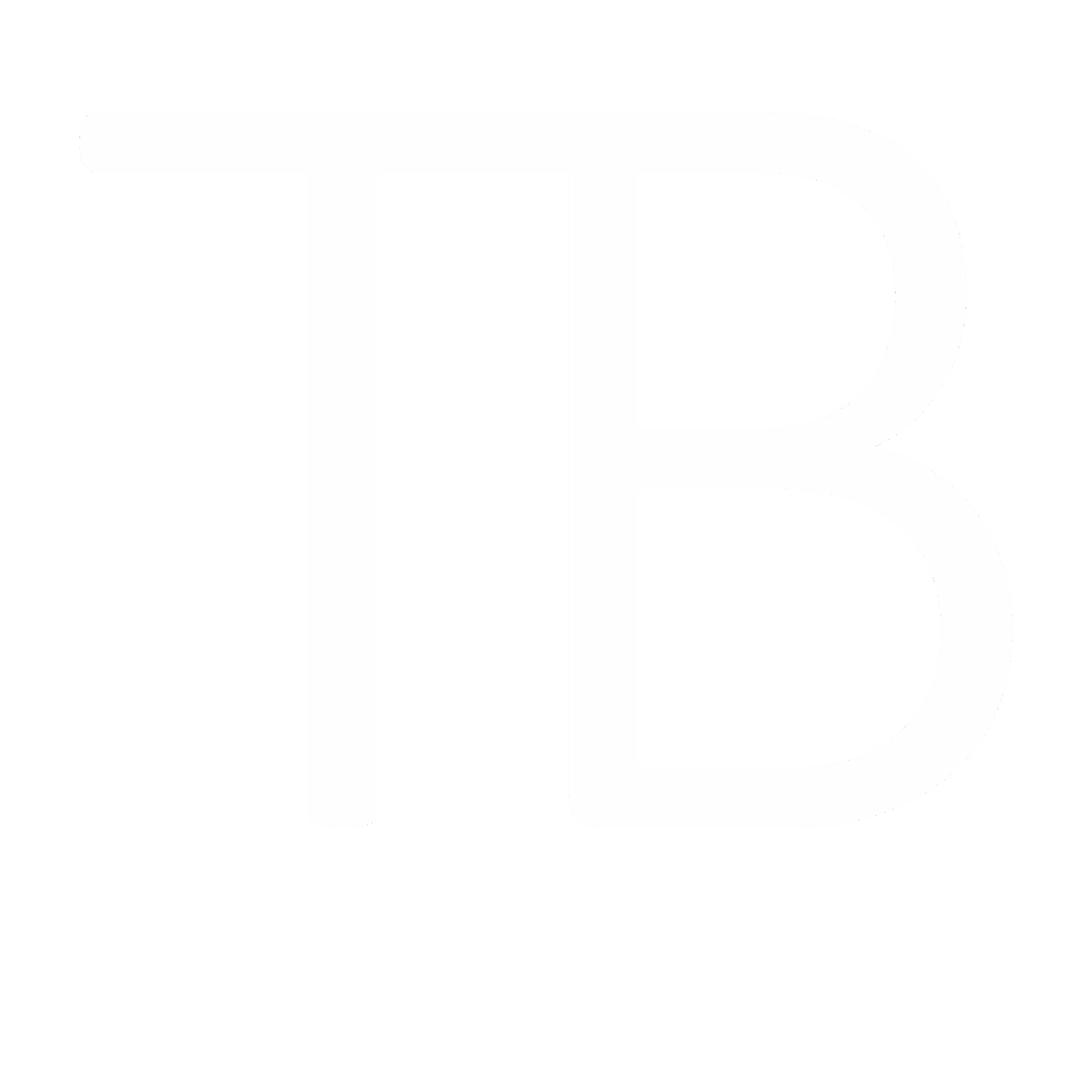Die Gründe für die erstaunliche Erfolgsgeschichte des chinesischen Konzerns enthalten für den Westen unangenehme Wahrheiten.

«Huawei wurde vom chinesischen Staat hochgezüchtet.» Diese Behauptung hält sich hartnäckig. Auf den ersten Blick spricht auch einiges dafür: Laut Berechnungen des «Wall Street Journal» hat das Unternehmen bis zu 75 Mrd. $ an staatlichen Darlehen, Kreditlinien, Beihilfen und Steuervergünstigungen erhalten. Steuerabzüge für Forschung und Entwicklung sind allerdings weltweit üblich. Im chinesischen Bankensystem spielen zudem staatliche Banken eine dominante Rolle. So ist es kaum verwunderlich, dass Huaweis internationale Expansion auch durch Kredite von Staatsbanken wie der China Development Bank finanziert wurde.
Die Vorstellung, Huawei sei dank der Unterstützung der Kommunistischen Partei im Schlafwagen zum globalen Konzern aufgestiegen, ist unplausibel. Das zeigen zwei Gegenbeispiele: Die Kaufwut der HNA-Gruppe und des Versicherungsriesen Anbang im Ausland endete im Fiasko. Beiden chinesischen Unternehmen wurden gute Kontakte zur politischen Elite nachgesagt, sie hingen am Tropf der Staatsbanken – und mussten Insolvenz anmelden. Als «nationaler Champion» aus der Technologiebranche mag Huawei für Peking eine andere Bedeutung haben. Dessen Aufstieg zum weltweit führenden Telekomausrüster – und zeitweise zweitgrössten Smartphone-Hersteller – gehört dennoch zu den grössten unternehmerischen Leistungen der vergangenen Jahrzehnte.
«Chefs den Rücken zukehren»
Dass dies ausgeblendet wird, mag neben berechtigten sicherheitspolitischen Bedenken auch einem westlichen Überlegenheitsgefühl geschuldet sein. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Somit gibt es auch nichts, was man von Huawei und dem Unternehmensgründer Ren Zhengfei lernen könnte. Doch genau das ist eine interessante Frage: Was steckt hinter dem Aufstieg Huaweis? Laut Tian Tao, einem Berater und halboffiziellen Konzernhistoriker, lässt sich der Erfolg mit sechs Führungsprinzipien erklären. Jedes davon wird im Folgenden mit einem Zitat von Ren, der das Unternehmen seit über dreissig Jahren als CEO führt, konkretisiert:
- Fokus auf die Kunden: «Alle Mitarbeiter des Unternehmens müssen ihren Blick auf die Kunden richten und ihren Vorgesetzten den Rücken zukehren. Macht euch nicht mit Powerpoint-Folien verrückt, die eure Chefs beeindrucken sollen.»
- Hingabe: «Mit einer 40-Stunden-Woche bekommt man nur gewöhnliche Angestellte, aber niemals Musiker, Tänzer, Wissenschafter, Ingenieure oder Unternehmer.»
- Philosophie der Grautöne: «Wenn die Manager, die wir rekrutieren, makellose Menschen wären, dann wären es Heilige, Mönche oder sogar Priester. Das ist nicht das, wonach wir suchen. Was wir suchen, sind starke Kämpfer, die eine Armee bilden können.»
- Kompromisse: «Eine Führungskraft muss lernen, Entscheidungen in einem offenen Umfeld zu treffen, in dem sie Einschränkungen unterworfen ist. Sie darf keine Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren, denn ich glaube, ihr Gesicht hat nicht oberste Priorität.»
- Selbstkritik: «Jeder Manager, der nicht zur Selbstkritik fähig ist, sollte nicht befördert werden. Wir sollten diejenigen, die nie Kritik einstecken mussten, gut im Auge behalten.»
- Offenheit: «Nur wenn wir unseren bornierten Nationalstolz und Huawei-Stolz abschütteln, können wir ein wirklich globales, professionelles und reifes Unternehmen werden.»
Die meisten Unternehmen behaupten von sich, sie seien kundenzentriert. Doch nur wenige sind es wirklich. In Grosskonzernen besteht stets die Gefahr, dass Eigeninteressen überhandnehmen. Manager streben nach Boni und Sozialprestige. Abteilungen ringen gegeneinander um Budget und Aufmerksamkeit von oben. Und die Meinung des Vorgesetzten ist oft wichtiger für die Zukunft von Mitarbeitern als jene der Kunden. Sich gegen diese Kräfte zu stemmen, ist eine Sisyphusarbeit. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften macht zusammen mit dem gesellschaftlichen Wertewandel die Aufgabe noch schwieriger. Ein Unternehmen, das einfach nur die Bedürfnisse der Kunden befriedigen will, gilt bei der jüngeren Generation als wenig attraktiver Arbeitgeber. Deshalb sind Unternehmen zunehmend auf der Suche nach einem «Purpose», einem höheren Zweck, der über simples Gewinnstreben hinausgeht.
Unternehmensziel: überleben
Dem kann der 76-jährige Ren Zhengfei wenig abgewinnen. Er gründete das Unternehmen 1987 nicht, um die Welt zu verändern: «Kunden zu dienen, ist der einzige Grund, warum Huawei existiert.» Ren war im Zuge der militärischen Abrüstung aus der Volksbefreiungsarmee entlassen worden. Der Offizier und Ingenieur war im Alter von 40 Jahren gezwungen, sich eine neue Existenz aufzubauen. Ren entstammt einer Generation, die bittere Armut erlebt hat. Wohl auch deshalb war das Unternehmensziel von Huawei denkbar einfach: überleben.
Zu jener Zeit waren Privatunternehmen in China noch suspekt. Erst nach Maos Tod hatte Deng Xiaoping ab 1978 marktwirtschaftliche Öffnungsschritte eingeleitet. In Shenzhen, damals noch eine Kleinstadt, liess der Staats- und Parteichef 1980 die erste Sonderwirtschaftszone errichten. Das kapitalistische Laboratorium erwies sich als Erfolg. Die Regierung liess Shenzhen einzäunen, um die Zuwanderung aus dem restlichen China zu begrenzen. Es erwies sich als Glücksfall, dass Huawei auf der richtigen Seite des Zaunes gegründet wurde. Zunächst importierte Huawei Telefonanlagen aus Hongkong und verkaufte diese in China an Postämter oder Behörden. Manche sagen, dabei seien auch Rens Beziehungen aus seiner Zeit in der Armee hilfreich gewesen. Laut Tian Tao, der ein Buch über Huawei geschrieben hat, prägte diese Zeit die Firmenkultur: Das Unternehmen funktionierte wie eine eingeschworene Bande. Bandenführer Ren forderte von seinen «Wolfskriegern», «schamlos» zu sein. Sich gegen die staatliche und ausländische Konkurrenz zu behaupten, war nicht leicht. Zumal Huawei Produkte von zweifelhafter Qualität verkaufte. Dies gelang nur mit einem an Selbstaufopferung grenzenden Service.

Schlaf als Versagen
Trotz den schwierigen Anfängen glaubte Ren schon früh an den ganz grossen Erfolg – oder tat zumindest so. Als er für Huawei-Mitarbeiter kochte, soll er einmal aus der Küche gestürmt sein, mit einem Kochlöffel herumgefuchtelt und den Mitarbeitern prophezeit haben: «In zwanzig Jahren wird Huawei ein Unternehmen von Weltrang sein und zu den vier grössten Telekomausrüstern gehören.» Damals, fünf Jahre nach der Gründung, hatte Huawei wenige hundert Mitarbeiter. 1994 schaffte Huawei mit dem ersten Eigenprodukt den Durchbruch in China: mit einer für ländliche Regionen konzipierten, robusten Telefonvermittlungsanlage. Sie war das Resultat durchwachter Nächte, in denen Ren die Ingenieure mit grossmäuligen Reden bei Laune hielt. Wenn die Ingenieure bis spät in die Nacht an den neuen Produkten arbeiteten, übernachteten sie auf Matratzen unter den Schreibtischen. Diese sogenannte «Matratzenkultur» geriet in den chinesischen Medien in die Kritik, als es zu mehreren Suiziden unter Huawei-Mitarbeitern kam.
In einem Essay rechtfertigte Ren die langen Arbeitstage mit Beobachtungen, die er bei einer Reise durch das Silicon Valley gemacht haben will: Für amerikanische Programmierer und Forscher sei Schlaf gleichbedeutend mit Versagen, schrieb Ren. Angetrieben von grossen Ambitionen und stimuliert durch Kaffee, schafften sie es, «bis vier, fünf oder sogar sechs Uhr morgens vor ihren fluoreszierenden Bildschirmen wach zu bleiben, weit entfernt von der verlockenden Behaglichkeit ihrer Betten zu Hause». Der Hightech-Sektor gehöre wie der Sport den jungen Leuten, bilanzierte Ren. Statistiken zeigten, dass die meisten Mitarbeiter alleinstehend, männlich und unter 35 Jahre alt seien. Es könnte eine unschöne Wahrheit sein, die das Beispiel Huawei lehrt: Mitarbeiter, die ihre Arbeit als sinnstiftend empfinden, dürften zwar produktiver und innovativer sein als der Prototyp des «Lohnsklaven». Doch alles hat seinen Preis: Wer das Wohl der Mitarbeiter an die oberste Stelle stellt, verliert die Kunden aus dem Auge.
Vielleicht geben sich Firmen aus Europa und Nordamerika vor allem deshalb einen postmateriellen Anstrich und sorgen sich um die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter, weil ihnen der Arbeitsmarkt dies diktiert. Gute Ingenieure und Software-Entwickler sind rar und kostbar. Huawei kann hingegen auf einen riesigen Pool hungriger Universitätsabgänger zurückgreifen, die vor allem an materiellem Aufstieg interessiert sind. Wenn ein Programmierer im Alter von 35 «verheizt» ist, kann er schnell ersetzt werden. So unschön das sein mag – es ist ein Wettbewerbsvorteil für Huawei. Dass sich eine solche Arbeitskultur und Personalpolitik in westlichen Firmen kopieren lässt, darf bezweifelt werden. Huawei hat aber auch eine andere Seite: Ren mag ein Haudegen sein, der gerne militärisches Vokabular benutzt. Aber er ist auch ein neugieriger und weltoffener Intellektueller. Man könnte sogar sagen, dass er einem humanistischen Bildungsideal anhängt. Ren ermutigt Manager und Forscher, mit einflussreichen Menschen aus aller Welt Gedanken auszutauschen.
Das soll ausdrücklich bei einer Tasse Kaffee geschehen. Kaffee ist für Ren ein Symbol für eine globalisierte Kultur, während Tee für das traditionelle China steht. Nach einer Bildungsreise durch die USA, auf der Ren und seine vier Mitstreiter hauptsächlich chinesische Gerichte gegessen hatten, sagte Ren: «Um international zu sein, müssen wir einen westlichen Magen entwickeln und lernen, Käse zu essen.» Auch als sich abzeichnete, dass das Unternehmen wegen seines Wachstums nicht mehr wie eine Gangsterbande funktionieren konnte, holte sich Ren Hilfe aus dem Ausland: IBM-Berater führten ein zeitgemässes Managementsystem ein. Ob Mao, die amerikanische Verfassung, Konfuzius oder die Glorious Revolution von 1688 in England – Ren interessiert sich für fast alles. Und er findet überall Ideen, die aus seiner Sicht für Huawei relevant sind. Ren ist ein Philosoph der Unternehmensführung. Es stellt sich eine rhetorische Frage: Wie viel wissen westliche Konzernchefs über asiatische Geschichte, Kultur und Religionen?
Ren Zhengfeis Traum, aus Huawei ein «wirklich globales Unternehmen» zu formen, dürfte dennoch scheitern. Das Unternehmen ist mit seinen fast 200 000 Mitarbeitern zwar in 170 Ländern aktiv. Doch die USA haben Huawei mit Sanktionen vom Bezug leistungsfähiger Chips abgeschnitten. Länder wie Grossbritannien und Schweden haben das Unternehmen vom 5G-Netzausbau ausgeschlossen. Zudem hat die US-Regierung Google verboten, Geschäfte mit Huawei zu tätigen. Die Folge: Wer ein Huawei-Smartphone kauft, muss seit 2019 ohne den App-Shop von Google auskommen, den sogenannten Play Store. In der Folge ist der Smartphone-Verkauf von Huawei in Europa eingebrochen.
Um dem Gegenwind bei den Smartphones und der Telekomausrüstung auszuweichen, versucht Huawei in andere Geschäftsfelder vorzustossen. Laut der Marktforschungsfirma Gartner erreicht das Unternehmen hinter Amazon, Microsoft, Google und Alibaba den fünftgrössten Marktanteil bei den Cloud-Dienstleistungen. Auch der Genfer Konzern Temenos, der mit seiner Bankensoftware mehr als 3000 Banken bedient, ist jüngst eine Partnerschaft im Cloud-Bereich mit Huawei eingegangen. Im Mai schrieb Ren in einem Memo an die Mitarbeiter, der Konzern solle seine Position im Heimmarkt stärken. Aber nicht nur: «Sobald wir Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Afrika dominieren, können die USA nicht mehr in unser Gebiet eindringen, wenn die US-Standards nicht mit unseren mithalten können.»
Auf dem Radar der Politik
Dass sich Huawei mit überlegenen Produkten in Europa unentbehrlich machen könnte, ist eine naive Vorstellung. Sollte es dem Konzern dereinst gelingen, etwa im Cloud-Bereich eine ähnlich starke Stellung einzunehmen wie heute bei der Telekomausrüstung, wird auch dies Washington missfallen – und Sanktionen nach sich ziehen. Irgendwann wird sich Ren eingestehen müssen, dass sein Traum geplatzt ist. Er hat mit Huawei zwar den ersten chinesischen Weltkonzern aufgebaut, der es mit Innovationsgeist zur Technologieführerschaft gebracht hat. Doch im Westen wird die chinesische Herkunft ein Handicap bleiben.
Man könnte es das Huawei-Paradoxon nennen: Der Aufstieg Huaweis an die Weltspitze war nur möglich, weil Ren dem Unternehmen eine kulturelle Öffnung verschrieb. Man bediente sich bei den Besten, gerade auch bei US-Firmen. Der dadurch ermöglichte Markterfolg im Westen sorgte wiederum dafür, dass Huawei auf dem Radar der Politik landete. Wäre Huawei ein technologisch rückständiger, aber billiger Telekomausrüster geblieben, wäre die Firma kaum als Gefahr für die nationale Sicherheit betrachtet worden. Das ist die Tragik des Ren Zhengfei: Je westlicher und erfolgreicher sein Unternehmen wurde, umso stärker wurde es als chinesisch wahrgenommen.
(Quelle: https://epaper.nzz.ch/article/783/783/2021-08-02/17/286749818)